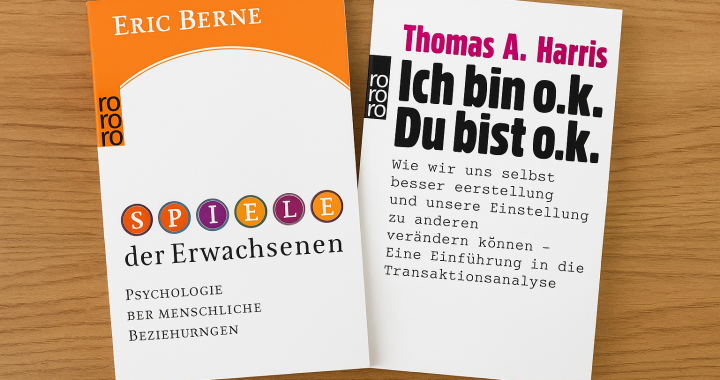In Zeiten von agilen Teams, hybriden Meetings und ständiger Veränderung dreht sich Führung mehr denn je um Kommunikation. Um den Ton und die Haltung. Und darum, Menschen zu verstehen. Und zwar auch dann, wenn sie sich selbst gerade nicht verstehen.
Viele Modelle kommen und gehen. Doch zwei Bücher, die in den 1960er-Jahren erschienen sind, bleiben aktuell:
– „Spiele der Erwachsenen“ von Eric Berne
– „Ich bin o.k. – Du bist o.k.“ von Thomas A. Harris.
Beide Bücher habe ich in diesem Sommer mit großem Interesse erneut gelesen und vieles daraus mitnehmen können. Kennst du Situationen, die vollkommen verfahren erscheinen? In denen sich Kommunikationsabläufe immer wiederholen und zu keinem Ergebnis führen? Und in denen eine Dynamik das Verhalten von Gesprächspartner:innen zu steuern scheint, die sich logischen Mustern auf den ersten Blick entzieht?
In diesen Fällen lohnt sich häufig ein zweiter Blick, einer auf die Psycho-Logik. Berne und Harris gehören zu den Begründern der Transaktionsanalyse (TA) – einer psychologischen Theorie, die erklärt, wie Kommunikation funktioniert, warum sie scheitert und wie wir sie bewusst gestalten können. Als Transaktion bezeichnet Berne das, was passiert, wenn eine Person etwas sagt, tut oder ausdrückt und die andere Person darauf reagiert.
Mir hat die Lektüre beider Bücher geholfen, für konkrete Situationen und Verhaltensweisen ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Und aus der Dynamik auszusteigen. Zugegeben, manche Beispiele in den Büchern spiegeln Rollenmuster aus den 1960er-Jahren. Die beschriebenen Grundprinzipien gelten dennoch und lassen sich auf vergleichbare Konstellationen im Heute übertragen.
Für Führungskräfte ist die Transaktionsanalyse mehr als ein psychologisches Modell: Sie ist ein Werkzeug der Selbstreflexion, ein Kompass für schwierige Gespräche und eine Landkarte für Beziehungsdynamiken im Team. Wer führt, ist permanent in Transaktion, also in Austausch. Zwischen Worten, Haltungen, Erwartungen. Zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was (unterbewusst) mitschwingt.
Eric Berne und die Entstehung der Transaktionsanalyse
Eric Berne war ein ungewöhnlicher Psychiater. Er wollte Psychologie nicht akademisch erklären, sondern für den Alltag verständlich machen. Für ihn war menschliche Kommunikation kein Rätsel, sondern ein System – mit Regeln, Rollen und Mustern. Bernes zentrales Modell unterscheidet drei Ich-Zustände, die in jedem Menschen angelegt sind. Sie spiegeln, aus welcher inneren Haltung heraus wir sprechen, fühlen und handeln – und sie prägen jede Form der Kommunikation, ob privat oder beruflich.
Das Eltern-Ich – geprägt von Regeln, Werten und Erfahrungen
Das Eltern-Ich entsteht aus all den Botschaften, die wir in unserer Kindheit aufgenommen haben: aus Sätzen wie „So macht man das!“ oder „Reiß dich zusammen!“. Es umfasst zwei Seiten:
- das kritische Eltern-Ich: normgebend, bewertend, korrigierend („Das geht gar nicht!“, „Das gehört sich so“),
- das fürsorgliche Eltern-Ich: schützend, unterstützend, ermutigend („Ich helfe dir dabei“, „Ich fühle mich verantwortlich“).
In der Führung zeigt sich das Eltern-Ich etwa, wenn du klare Anweisungen gibst, Regeln betonst oder Verantwortung übernimmst. Im gesunden Maß sorgt es für Orientierung und Struktur. Wird es zu dominant, kippt es in Bevormundung oder Kontrolle.
Das Erwachsenen-Ich – die Stimme der Vernunft
Das Erwachsenen-Ich ist der ausgewogene und reflektierte Ich-Zustand. Hier bewertest du Informationen sachlich, trennst Emotion von Situation und suchst nach Lösungen. Typisch sind Aussagen wie: „Lass uns die Fakten prüfen“ oder „Welche Optionen haben wir?“ In diesem Zustand bist du präsent, rational und handlungsfähig. Du reagierst nicht, du entscheidest.
Führung auf Augenhöhe basiert vor allem auf diesem Ich-Zustand: Du hörst zu, prüfst und wägst ab. Und dann kommunizierst du klar, ohne zu verletzen.
Das Kind-Ich – Quelle von Emotion, Kreativität und Impuls
Das Kind-Ich steht für das, was wir als Kinder gefühlt und gelernt haben. Auch hier gibt es verschiedene Seiten:
- das freie Kind-Ich: spontan, kreativ, begeisterungsfähig („Das probiere ich einfach mal!“, „Das macht Spaß!“),
- das angepasste Kind-Ich: vorsichtig, konfliktscheu, unterordnend („Ich halte lieber den Mund“, „Ich muss gefallen, damit mir nichts passiert“).
- das rebellisch-trotzige Kind-Ich: uneinsichtig, widerspenstig („Wie du mir, so ich dir“, „Du hast mir gar nichts zu sagen“).
In Führungssituationen kann das freie Kind-Ich Inspiration und Nähe schaffen – etwa, wenn du Freude teilst, Ideen entwickelst oder Humor zeigst. Das angepasste Kind-Ich dagegen zeigt sich, wenn du Konflikten ausweichst oder dich innerlich zurückziehst, statt klar zu bleiben. Oder wenn du dich zu sehr anpasst, um Harmonie zu wahren. Eine positive Seite des rebellischen Kind-Ichs ist die Abgrenzung und der Blick auf die eigenen Bedürfnisse. Problematisch wird es, wenn eine Person beispielsweise eher bockig reagiert, wo Einsicht angebracht wäre.
Das Zusammenspiel der drei Ich-Zustände
Wir alle schalten ständig zwischen diesen Zuständen um. In einem Moment gibst du klare Anweisungen („Bitte bis Freitag erledigen!“ – Eltern-Ich), im nächsten erklärst du ruhig und sachlich die Hintergründe einer Entscheidung (Erwachsenen-Ich). Und manchmal reagierst du genervt, weil eine Mitarbeiterin gerade nicht so reagiert, wie du es gebraucht hättest („Das kann doch nicht sein!“ – Kind-Ich).
Bernes Idee war revolutionär, weil sie Kommunikation beobachtbar und steuerbar machte. Statt unbewusst zu reagieren, kannst du erkennen, aus welchem Ich-Zustand du gerade sprichst und aus welchem dein Gegenüber antwortet. Dadurch wird Kommunikation nicht nur bewusster, sondern auch gestaltbar: Du kannst gezielt in den Erwachsenenmodus wechseln, um ein Gespräch zu deeskalieren oder Missverständnisse aufzulösen.
Was das für Führung bedeutet
Führung heißt, Verantwortung für den Kommunikationsraum zu übernehmen. Wenn du als Führungskraft im Erwachsenen-Ich bleibst, gibst du Orientierung, ohne zu bevormunden. Du forderst, ohne zu kontrollieren. Und du bleibst klar, auch wenn Emotionen hochkochen. Das ist leichter gesagt als getan. Besonders, wenn Stress, Konflikte oder Machtspiele ins Spiel kommen, fällt es schwer. Und genau hier setzt Bernes zweites großes Konzept an: die psychologischen „Spiele“.
„Spiele der Erwachsenen“: Wenn Kommunikation zur Bühne wird
Bernes Bestseller „Games People Play“ („Spiele der Erwachsenen“) erschien 1964 – und machte ihn weltberühmt. Er beschreibt darin immer wiederkehrende Kommunikationsmuster, die Menschen unbewusst inszenieren, um sich zu bestätigen, zu schützen oder Schuld abzuwehren. Diese „Spiele“ laufen nach festen Drehbüchern ab. Es gibt klar verteilte Rollen: Opfer, Retter, Ankläger. Und sie enden fast immer mit Frust, Ärger oder Enttäuschung.
Typische Spiele im Führungsalltag
- „Warum passiert das immer mir?“
Ein Mitarbeitender beklagt immer wieder Hindernisse und erwartet Rettung. Die Führungskraft springt ein, löst das Problem, fühlt sich kompetent. Beim nächsten Mal wiederholt sich das Spiel – beide bleiben in ihren Rollen. - „Sieh, wie sehr ich mich bemühe“
Das Teammitglied rackert, übernimmt zu viel, will es allen recht machen und brennt langsam aus. Führungskräfte, die das nicht erkennen, verstärken unbewusst das Muster, indem sie Anerkennung für Überlastung signalisieren. - „Meins ist besser“
Eine Mitarbeiterin schlägt in der Teamsitzung eine neue Idee vor. Du hörst zu, aber statt wirklich darauf einzugehen, sagst du: „Das haben wir vor drei Jahren schon probiert, das funktioniert nicht.“ Oder: „Interessant, aber mein Ansatz wäre nutzwertiger.“ Hinter dem Drang, es besser zu wissen, steckt oft das Bedürfnis, Kontrolle zu behalten oder die eigene Erfahrung zu bestätigen. Das führt dazu, dass sich andere klein fühlen, zurückziehen oder irgendwann gar nichts mehr sagen.
Was Führungskräfte daraus lernen können
Diese Spiele sind keine Bosheit, sondern unbewusste Schutzstrategien. Sie entstehen, wenn Menschen Nähe suchen, ohne verletzlich zu sein. Nicht selten verbirgt sich dahinter außerdem ein Selbstwert-Thema. Als Führungskraft kannst du die Spiele durchbrechen, indem du nicht mitspielst. Du erkennst das Muster und gehst bewusst einen anderen Weg:
- Statt zu retten, stellst du Fragen („Was brauchst du, um das selbst zu lösen?“).
- Statt zu bewerten, spiegelst du („Mir fällt auf, dass dieses Thema öfter auftaucht. Wollen wir hinschauen?“).
- Statt andere zu übertrumpfen, erkennst du den Wert der anderen Perspektive und stärkst damit die Beziehung statt dein Ego.
„Ich bin o.k. – Du bist o.k.“ – Die Haltung entscheidet
Thomas A. Harris, ein Schüler von Berne, ging einen Schritt weiter. Er übersetzte die Theorie in eine einfache, aber machtvolle Botschaft: Führung beginnt mit innerer Haltung. In seinem Buch beschreibt Harris vier Grundhaltungen, aus denen Menschen handeln:
- Ich bin o.k. – Du bist o.k.
– Gleichwertigkeit, Vertrauen, Offenheit. - Ich bin o.k. – Du bist nicht o.k.
– Überlegenheit, Kontrolle, Misstrauen. - Ich bin nicht o.k. – Du bist o.k.
– Unterordnung, Anpassung, Minderwertigkeitsgefühl. - Ich bin nicht o.k. – Du bist nicht o.k.
– Resignation, Zynismus, Rückzug.
Nur die erste Haltung ermöglicht echte Kooperation. Sie ist das Fundament für gesunde Führung, gerade in unsicheren Zeiten.
Was das für die Praxis bedeutet
Wenn du im „Ich bin o.k. – Du bist o.k.“ agierst,
- gibst du Feedback auf Augenhöhe, ohne herabzusetzen,
- triffst du klare Entscheidungen, ohne andere kleinzumachen,
- schaffst du Raum für Fehler, ohne an Autorität zu verlieren.
Diese Haltung ist kein Soft-Skill, sondern ein Führungsprinzip. Teams folgen Menschen, die Vertrauen statt Angst ausstrahlen. Und Vertrauen entsteht, wenn sich alle Beteiligten – inklusive der Führungskraft – als „o.k.“ erleben dürfen.
Allerdings ist eine solche Haltung kein Dauerzustand. Jeder Mensch pendelt zwischen den verschiedenen Zuständen, je nach Situation. Wichtig ist, sie zu erkennen – besonders in Stressmomenten. Wenn du merkst, dass du innerlich denkst: „Jetzt reiß dich mal zusammen!“ (Eltern-Ich) oder: „Ich schaffe das nie!“ (Kind-Ich), dann hilft es, durchzuatmen und bewusst in den Erwachsenenmodus zurückzukehren:
„Was passiert hier gerade? Welche Verantwortung liegt bei mir, welche woanders?“
So entsteht Führung aus Klarheit statt Reaktion.
Zwei Klassiker, ein gemeinsames Ziel
Berne erklärt das „Was passiert“, Harris erklärt das „Wie man damit umgeht“. Der eine ist Analytiker, der andere Praktiker. Gemeinsam bilden die Theorien eine Art Doppelinstrument für moderne Führung:
- Berne hilft, unbewusste Spiele und Rollen zu erkennen.
- Harris zeigt, wie du sie durch bewusste Haltung verändern kannst.
Was moderne Führung daraus lernen kann:
- Selbstwahrnehmung als Führungsinstrument
Wer seine eigenen Ich-Zustände kennt, reagiert bewusster – auch in Konflikten. - Klarheit in der Kommunikation
Wenn du verstehst, woher eine Reaktion kommt, kannst du sie benennen, ohne zu bewerten. - Gesunde Verantwortungskultur
Führung auf Augenhöhe bedeutet: Verantwortung teilen, nicht abgeben. Und nicht alles retten wollen. - Nachhaltige Teamentwicklung
Teams, die in einer „Ich bin o.k. – Du bist o.k.“-Kultur arbeiten, sind konfliktfähiger, kreativer und loyaler.
Transaktionsanalyse in Zeiten von Social Media und Remote Work
In virtuellen Teams oder über Social Media verschiebt sich Kommunikation. Sie wird schneller, flacher, anfälliger für Missverständnisse. Eine kurze Nachricht ohne Emoji kann als kühl oder abweisend wirken. Ein sachlicher Hinweis wird als Kritik verstanden. Ein spontaner Kommentar aus dem Kind-Ich löst einen Eltern-Reflex beim Gegenüber aus und das Gespräch eskaliert.
Die Transaktionsanalyse bietet hier eine Art Navigationssystem für digitale Kommunikation: Sie erinnert dich daran, innezuhalten, bevor du sendest. Frag dich: „Aus welchem Ich spreche ich gerade?“ Und überlege: „Wie kommt das bei der anderen Seite an?“ Gerade Führung auf Distanz verlangt emotionale Feinfühligkeit. Wenn du weißt, dass jedes Wort, jede Geste eine Transaktion ist, gestaltest du sie bewusster, ob im Videocall, in Slack oder im Jour fixe. Die Modelle von Berne und Harris wirken damit wie analoge Anker in einer digitalen Welt. Sie bringen Menschlichkeit zurück in die Kommunikation.
Fazit: Kleine Klassiker mit großer Wirkung
„Spiele der Erwachsenen“ und „Ich bin o.k. – Du bist o.k.“ sind Bücher, die meinen Blick auf Kommunikation verändert haben. Sie lehren, dass Führung keine Technik ist, sondern ein Prozess. Dass wir alle alte Muster wiederholen. Und dass wir sie durch Bewusstheit verändern können. Letztlich beginnt gute Führung immer bei uns selbst.
Wenn du als Führungskraft lernst, deine eigenen Spiele zu erkennen und dich bewusst für eine „Ich bin o.k. – Du bist o.k.“-Haltung entscheidest, führst du nicht nur klüger – du führst menschlicher. Oder, um es auf den Punkt zu bringen: Wer führt, kommuniziert. Wer besser kommuniziert, führt besser.
TIPP
In meinen Coachings nutze ich die Transaktionsanalyse, um Führung verständlich, wirksam und menschlich zu machen. Gute Führung beginnt immer mit einem Satz: „Ich bin o.k. – und du auch.“