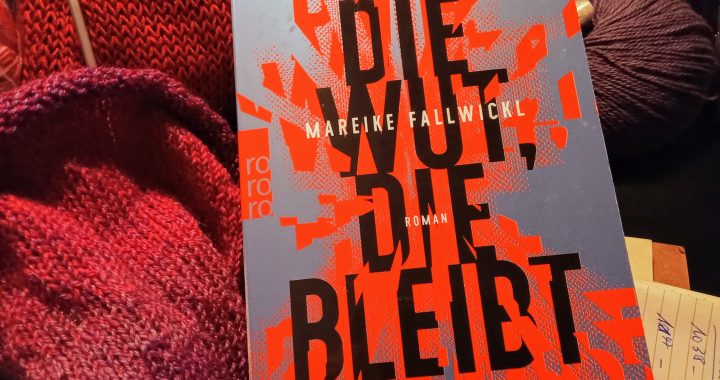Dieser Text ist eine Wucht. Sprachlich und inhaltlich. Autorin Mareike Fallwickl schildert in „Die Wut, die bleibt“ schonungslos die Situation vieler Frauen in Zeiten der Corona-Pandemie. Und schickt die Leserschaft auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ständig wechselnd zwischen Ohnmacht, Zorn, Resignation und Rebellion. Ein Buch, das wütend machen muss.
Schockierender Anfang
Lola steckt als Teenager mitten in der Pubertät, als ihre Mutter Helene beim Abendessen plötzlich aufsteht, zum Balkon geht und sich in den Tod stürzt. Mit diesem Akt beginnt der Roman und katapultiert die Zurückgebliebenen ins emotionale Chaos. Helene hinterlässt neben Lola zwei jüngere Söhne sowie ihren Ehemann und ihre beste Freundin Sarah, eine kinderlose Bestseller-Autorin, die mit Thrillern über Frauenmorde ihr Geld verdient.
Durchwirkt von Erinnerungen an die Zeit vor dem Suizid, handelt das Buch überwiegend von den Monaten danach. Protagonistinnen sind Lola und Sarah, die – jede auf ihre Art – mit dem Geschehen fertig zu werden versuchen. Während Lola immer stärker in die Rebellion geht, sich von gängigen Rollenbildern freistrampelt und ihrer Wut bald ungebändigt Ausdruck verleiht, wählt Sarah einen anderen Weg.
Schmerz und Schuld
Sie plagen Schuldgefühle, für Helene in Zeiten von Homeschooling und Shutdown nicht ausreichend da gewesen zu sein. Mit fast schmerzhafter Selbstverständlichkeit nimmt sie – mehr schlecht als recht – die Ersatz-Mutterrolle ein, kümmert sich um Kinder und Haushalt und hält Helenes Ehemann den Rücken frei. Der zieht sich gründlich aus der Verantwortung, verweilt in der Rolle des familiär eher unbeteiligten Versorgers und fühlt sich, glaubhaft leidend, als Opfer der Umstände.
Statt ihn konsequent in die Verantwortung zu nehmen, lässt Sarah ihn lange gewähren. Zu lange. Auch zu Hause, wo es sich ihr Freund in Sarahs Leben bequem gemacht hat, ohne Maßgebliches beizutragen, findet sich zunächst keine Strategie, ihre unterdrückte Wut zu kanalisieren. Durch Lolas Unerschrockenheit animiert, gelingt es Sarah schließlich, in beiden Kontexten einen Schlussstrich zu ziehen – ein regelrechter Befreiungsschlag! – und ihr Leben umzukrempeln.
Gefangen im Rollenbild
Kaum ein Buch hat mich im vergangenen Jahr so gefesselt wie „Die Wut, die bleibt“. Dabei schob ich die Lektüre lange vor mir her. Ich ahnte, dass sie mich sehr wütend machen könnte. Als kinderlose Frau liegt es nahe, dass ich mich im Roman eher mit Sarah identifizieren und Helenes Situation aus einer beobachtenden Rolle betrachten konnte. Aufgrund von Sarahs Erfahrungen als „Ersatz-Mutter“ verwischen die Ebenen allerdings miteinander.
Mehr und mehr rutscht Sarah in das Dilemma herein, das Helene verzweifeln ließ: Wie werde ich der Familie und zugleich mir selbst gerecht? Ein Unterfangen, dass auch außerhalb von Shutdowns und Pandemien den Alltag vieler Frauen prägt. Statt die (berechtigte) Wut über veraltete Rollenbilder, Mental Load und Ungleichheit auszuleben, sucht frau oft genug nach Erklärungen, nach Lösungen oder nach Gründen, warum am Ende nur doch wieder sie für eine gute Atmosphäre daheim verantwortlich ist.
Umdenken
Dabei ist Wut grundsätzlich kein schlechtes Gefühl – vorausgesetzt, es gelingt, durch sie ins Handeln zu kommen und die Dinge zum Besseren zu beeinflussen. Genau das aber gesteht sich Sarah lange nicht zu. Helene wählte schließlich einen maximal destruktiven Weg, um ihrer unerträglichen Situation zu entkommen, in die sie der Shutdown zwingt: raus aus dem Beruf, zurück an den Herd.
Einen möglichen Ausweg zeigt Lola auf, die aus einer anderen Perspektive auf Geschlechterstereotypen sowie Rollenbilder schaut. Sie liest Sarah wiederholt gehörig die Leviten. So zählten für mich die Auseinandersetzungen zwischen hinterbliebener Tochter und bester Freundin zu den Highlights des Romans. Zum Beispiel, als Lola Sarah aufzeigt, wie frauenfeindlich ihre Bücher sind. Ein Gedanke, gegen den sich Sarah zunächst wehrt, der sie schließlich aber zum Umdenken zwingt:
„Du bist eine misogyne Serientäterin“, erklärt Lola und hat dieses flatternde Gefühl in der Brust, weil sie alles gut erklären muss, bevor ihre Redezeit vorüber ist, bevor das Gegenüber nicht mehr zuhört oder ein Streit ausbricht, „deine Krimis sind frauenfeindlich. Sie normalisieren Gewalt gegen Frauen, die geschlagen und gefoltert werden, entführt, ermordet, zerstückelt. Und die Täter sind Männer. Deine Bücher tragen zu einem gesellschaftlichen Klima bei, in dem ein Femizid stets im Bereich des Möglichen liegt.“
Sprachlicher Ausdruck
Begeistert haben mich an vielen Stellen aber auch die Sprachbilder, die Mareike Fallwickl findet, um den Schmerz der Figuren in Worte zu fassen:
„Nie geht es um das, was da ist, stets geht es um das, was fehlt. Und das Schlimme ist, dieses neue Fehlen, das bleibt jetzt.“
„Lola schläft in Splittern.“
„Helenes Abwesenheit ist wie ein schmieriger Fingerabdruck auf einer Brille. Man sieht durch ihn durch und bemerkt ihn trotzdem.“
„Das sind Moment, in denen man sich nicht umarmen kann, weil sonst aufplatzt, was mühsam zugetackert wurde.“
Alles in allem kann ich den Roman sehr empfehlen. Es lohnt, die Wut auszuhalten und mit den Protagonistinnen durch den Schmerz zu gehen. Ein Buch, das im Gedächtnis bleibt.